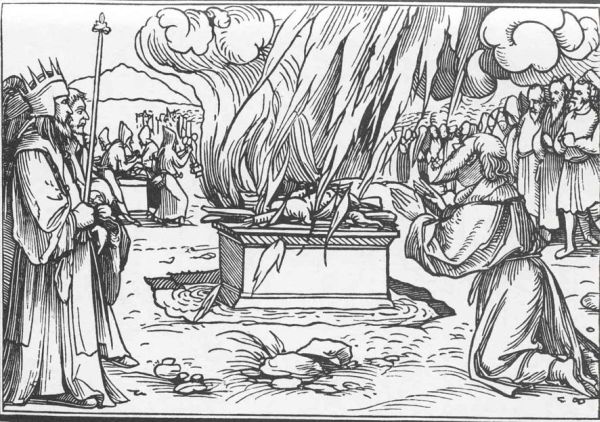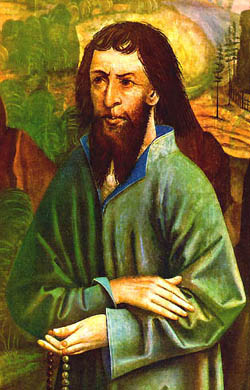Die praktische moraltheologische Bildung der Katholiken muss dringend aufgebessert werden – ich hoffe, da werden meine Leser mir zustimmen. Und ich meine hier schon auch ernsthafte Katholiken. In gewissen frommen Kreisen wird man heutzutage ja, wenn man Fragen hat wie „Muss ich heute Abend noch mal zur Sonntagsmesse gehen, wenn ich aus Nachlässigkeit heute Morgen deutlich zu spät zur Messe gekommen bin?“ oder „Darf ich als Putzfrau oder Verwaltungskraft in einem Krankenhaus arbeiten, das Abtreibungen durchführt?“ oder „Wie genau muss ich eigentlich bei der Beichte sein?“ mit einem „sei kein gesetzlicher Erbsenzähler!“ abgebügelt. Und das ist nicht hilfreich. Gar nicht. Weil das ernsthafte Gewissensfragen sind, mit denen manche Leute sich wirklich herumquälen können. Und andere Leute fallen ohne klare Antworten in einen falschen Laxismus, weil sie keine Lust haben, sich ewig mit diesen Unklarheiten herumzuquälen und meinen, Gott werde es eh nicht so genau nehmen, und wieder andere in einen falschen Tutiorismus, wobei sie meinen, die strengste Möglichkeit wäre immer die einzig erlaubte.
Auf diese Fragen kann man sehr wohl die allgemeinen moraltheologischen Prinzipien – die alle auf das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zurückgehen – anwenden und damit zu einer konkreten Antwort kommen. Man muss es sich nicht schwerer machen, als es ist. Und nochmal für alle Idealisten: „Das und das ist nicht verpflichtend“ heißt nicht, dass man das und das nicht tun darf oder es nicht mehr empfehlenswert oder löblich sein kann, es zu tun. Es heißt nur, dass die Kirche (z. B. in Gestalt des Beichtvaters) nicht von allen Katholiken verlangen kann, es zu tun.
Zu alldem verweise ich einfach mal noch auf einen meiner älteren Artikel. Weiter werde ich mich gegen den Vorwurf der Gesetzlichkeit hier nicht verteidigen.
Jedenfalls, ich musste öfters lange herumsuchen, bis ich zu meinen Einzelfragen Antworten gefunden habe, und deshalb dachte mir, es wäre schön, wenn heute mal wieder etwas mehr praktische Moraltheologie und Kasuistik betrieben/kommuniziert werden würde; aber manches, was man gerne hätte, muss man eben selber machen, also will ich in dieser Reihe solche Einzelfragen angehen, so gut ich kann, was hoffentlich für andere hilfreich ist. Wenn ich bei meinen Schlussfolgerungen Dinge übersehe, möge man mich bitte in den Kommentaren darauf hinweisen. Nachfragen sind auch herzlich willkommen. Bei den Bewertungen, was verpflichtend oder nicht verpflichtend, schwere oder lässliche oder überhaupt keine Sünde ist („schwerwiegende Verpflichtung“ heißt: eine Sünde, die wirklich dagegen verstößt, ist schwer), stütze ich mich u. a. auf den hl. Thomas von Aquin, ab und zu den hl. Alfons von Liguori, und auf Theologen wie Heribert Jone (1885-1967); besonders auf letzteren. Eigene Spekulationen werden (wenn ich es nicht vergesse) als solche deutlich gemacht. Alle diese Bewertungen betreffen die objektive Schwere einer Sünde; subjektiv kann es Schuldminderungsgründe geben. Zu wissen, ob eine Sünde schwer oder lässlich ist, ist für die Frage nützlich, ob man sie beichten muss, wenn man sie bereits getan hat; daher gehe ich auch darauf ein; in Zukunft muss man natürlich beides meiden.
Wer nur knappe & begründungslose Aufzählungen von christlichen Pflichten und möglichen Sünden sucht, dem seien diese beiden Beichtspiegel empfohlen. (Bzgl. dem englischen Beichtspiegel: Wenn hier davon die Rede ist, andere zu kritisieren, ist natürlich ungerechte, verletzende Kritik gemeint, nicht jede Art Kritik, und bei Ironie/Sarkasmus ist auch verletzende Ironie/Sarkasmus gemeint.)

(Der hl. Alfons von Liguori (1696-1787), der bedeutendste kath. Moraltheologe des 18. Jahrhunderts. Gemeinfrei.)
Alle Teile hier.
–
Die wichtigsten ethischen Pflichten kann man anhand der 10 Gebote durchgehen. Das 1. lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es gibt nur einen Gott; und dem gebührt der vorrangige Platz im Leben. Im dritten Teil bin ich schon darauf eingegangen, wieso es richtig und geboten ist, an Gott zu glauben, auf Gott zu hoffen und Gott zu lieben; außerdem schreibt das 1. Gebot vor, Gott zu ehren und anzubeten, und verbietet, irgendetwas Ihm in dieser Hinsicht gleichzustellen. Auf Glaube, Hoffnung und Gottesliebe bin ich in den letzten drei Teilen noch näher eingegangen; jetzt also zur rechten Gottesverehrung und dazu, was dagegen verstößt.
Es geht bei der Gottesverehrung nicht darum, dass Gott menschliche Verehrung nötig hätte, sondern einfach darum, dass sie angemessen ist, dass sie Ihm zusteht – wie es angemessen ist, das Grab eines Familienmitglieds zu pflegen, auch wenn das dem Toten nichts „bringt“. Der hl. Thomas von Aquin sieht die Gottesverehrung als eine Untertugend der Gerechtigkeit. Außerdem nützt die Gottesverehrung dem Menschen selbst, indem sie ihn auf Gott, sein höchstes Gut, in dem er sein Glück findet, ausrichtet; Hauptziel der Gottesverehrung ist aber die Verherrlichung Gottes, nicht der Nutzen des Menschen.
Sie ist keine rein geistige Sache, sondern muss sich auch in körperlichen Handlungen ausdrücken, weil der Mensch ein Wesen aus Körper und Seele ist. Thomas schreibt wiederum:
„Ich antworte, Gott erweisen wir Ehre; — nicht zwar um Seinetwillen, denn Er ist voll von Herrlichkeit; sondern unsertwegen, damit wir, indem wir Gott ehren, unseren Geist Ihm unterwerfen. Denn darin besteht die Vollendung unseres Geistes; wie ja jede Kreatur dadurch vollendet wird, daß sie dem Höheren unterthan ist. So wird der Körper vollendet dadurch, daß er von der Seele belebt wird; die Luft dadurch, daß die Sonne sie durchleuchtet. Der menschliche Geist aber bedarf, um mit Gott verbunden zu werden, der Anleitung durch das Sinnliche, da ‚das Unsichtbare Gottes erkannt wird vermittelst des Sichtbaren.‘ (Röm. 1.) Deshalb muß man körperliche Thätigkeiten in die Gottesverehrung aufnehmen, damit dadurch wie durch Zeichen der Menschengeist aufgeweckt werde, um mit Gott sich zu verbinden. Die inneren Akte also in der Gottesverehrung sind die maßgebenden; die äußeren notwendig, aber an zweiter Stelle.“ (Summa Theologiae II/II,81,7)
Daher ist z. B. das Knien vor Gott gut, aber wenn jemand nicht mehr knien kann, macht das nichts, weil die innerliche Hingabe das Eigentliche ist.
Gott allein gebührt die Anbetung, was bedeutet, Seine absolute Erhabenheit und unsere absolute Abhängigkeit von ihm anzuerkennen, sich Ihm vollkommen zu unterwerfen.
Diese Anbetung ist der ganzen Person Jesus (nicht nur Seiner Gottheit, weil Seine Menschheit und Seine Gottheit in der hypostatischen Union untrennbar verbunden sind) und dementsprechend auch dem Allerheiligsten Sakrament – dem gewandelten Brot und Wein – geschuldet, weil es sich hier wirklich um Jesus handelt. Auf eine indirekte Weise betet man Gott an, indem man Dinge mit engem Bezug zu ihm, also z. B. bildliche Darstellungen Jesu, Kreuzesreliquien, die Orte des Lebens und Leidens Jesu usw., ehrt (nur ehrt, nicht selbst anbetet); eine vergleichbare Verehrung ist auch den Gott besonders nahen Personen, die seine Herrlichkeit spiegeln, also den Engeln und den Heiligen im Himmel, insbesondere der von Ihm über alle anderen Geschöpfe erhobenen Muttergottes geschuldet; und auch bei ihnen ehrt man mit ihnen zusammenhängende Gegenstände und ihre Leichname.
Bei der Anbetung Gottes spricht man von latria, bei der Heiligenverehrung von dulia, bei der besonderen Verehrung der Gottesmutter von hyperdulia.
Öffentliche Verehrung in der gesamten Weltkirche ist für die Heiligen erlaubt; öffentliche lokale Verehrung in ihrer Diözese für die Seligen; private Verehrung für alle Toten, von denen jemand meint, dass sie verehrungswürdig und im Himmel sind.
Gott kommt auch das Opfer zu, worüber der hl. Thomas sagt: „Das äußerliche Opfer nun ist ein Zeichen des innerlichen, kraft dessen die Seele sich selbst Gott aufopfert“ (Summa Theologiae II/II,85,2); und: „Das Gute in der Seele wird im inneren Opfer durch die Andacht, durch das Gebet und dergleichen innere Akte Gott dargebracht; und das ist das hauptsächlichste Opfer. Das Gute des Körpers wird dargebracht im Martyrium und im Fasten; die äußeren Güter direkt im Opfer [gemeint sind z. B. die Spenden an die Kirche bei der Gabenbereitung], mittelbar in Almosen, die wir um Gottes willen geben.“ (Summa Theologiae II/II 85,3) Und:
„Ich antworte, zum innerlichen Opfer seien alle verpflichtet; denn alle sollen einen andachtsvollen Geist Gott darbringen. Mit Rücksicht auf das äußerliche Opfer aber muß unterschieden werden. […] Dann aber 2. können die anderen Tugendwerke, die schon an sich etwas Gutes sind und Wert haben, zur Bezeigung der Ehrfurcht vor Gott benützt werden; und von solchen Tugendwerken sind manche geboten und manche nicht. […]
Die Priester opfern jene Opfer, die zum Kulte Gottes eigens und von vornherein bestimmt sind, für sich und für andere. Außerdem giebt es Opfer, die jeder für sich darzubringen hat.“ (Summa Theologia II/II,85,4)
Natürlich kann man in einem anderen Sinn auch sagen, dass man sich für andere Menschen „aufopfert“; aber hauptsächlich und zuallererst opfert man eben Gott durch Gebet, die Einhaltung der Fastenregeln usw., Priester durch die Darbringung des Messopfers, an dem die Laien auch teilnehmen, usw. Jedenfalls ist es angemessen, Gott, von dem man alles hat, quasi etwas „zurückzugeben“, auch wenn Gott einen bekanntlich nicht braucht, und das, was man Ihm zurückgibt, ob Zeit, Aufmerksamkeit, Bequemlichkeit, bestimmte Dinge etc., auch von Ihm ist, oder sogar Er selber ist (im Messopfer). Das einzige vollkommene Opfer ist das Opfer Jesu am Kreuz, und wir können uns mit diesem Opfer vereinigen.
Das Gebet (also die Erhebung des Herzens zu Gott, die Anrufung Gottes, die Bitte an Gott um das, was man braucht) ist eine Pflicht der Gottesverehrung. Ab wann die Vernachlässigung des Gebets zur Sünde wird, ist unter den klassischen Moraltheologen umstritten; auch bei der Messe betet man schon, wenn man dabei teilnimmt; und ansonsten üblich sind meistens das Morgen-, das Abend- und das Tischgebet; aber wenn man dafür keine Zeit oder Gelegenheit hat, kann man sie auch durch Gebete zu anderen Zeiten ersetzen. Wenn man nicht zumindest täglich irgendwann mal ein wenig betet, dürfte das meistens eine lässliche Sünde sein; gar nicht zu beten an sich eine schwere. Der hl. Alfons rechnet es als sicher schwere Sünde, wenn man einen Monat lang nicht gebetet hat. Auch mit dem Gebet ehrt man Gott als den, auf den man angewiesen ist und von dem man Hilfe erwarten kann; und Jesus hat das Gebet klar befohlen; es ist auch deshalb befohlen, weil es nötig ist als Hilfe gegen Versuchungen. Auch und gerade dann, wenn das Gebet einem schwerfällt und man sich dazu durchringen muss, hat es großen Wert vor Gott. Ablenkung im Gebet ist eine lässliche Sünde.
Für Kleriker und einige Ordensleute, zu deren Ordensleben das Chorgebet gehört, ist das Brevier (Stundengebet) verpflichtend (außer natürlich bei Dispens, Krankheit, anderweitiger Verhinderung); s. dazu Can. 276 § 2 Nr. 3 und Can. 1173-1175.
Heilige, Engel und andere Menschen auf der Erde kann man um ihre Fürbitte bitten; das Gebet im engen Sinn richtet sich an Gott.
Wenn jemand Anbetung, Opfer, Gebet völlig unterlässt und sich nicht um Gott kümmert, wäre das demnach prinzipiell schwere Sünde. Das kann man als praktischen Atheismus bezeichnen. Theoretischer Atheismus, der die Existenz Gottes leugnet (in seinen verschiedenen Formen: atheistischer Humanismus, der meint, dass der Mensch sich selbst genügt, atheistischer Materialismus, der meint, dass das Materielle alles sei, usw.), Agnostizismus, der die Gottesfrage für nicht entscheidbar erklärt, und religiöser Indifferentismus, der sie für unwichtig und alle Formen der Gottesverehrung für gleich gut oder schlecht erklärt, sind ebenfalls Sünden gegen die Gott geschuldete Verehrung, vor allem, da sie meistens aus Undankbarkeit, Desinteresse, bewusster Blindheit, aus der Einstellung, dass Gott, selbst wenn es Ihn geben sollte, nicht wichtig wäre, o. Ä. kommen. Häufig findet man ja z. B. eher die Einstellung, dass jemand sich Agnostiker nennt, weil ihm das gerade gefällt und dieses Label keine Verpflichtung und Festlegung bedeutet; das wäre Sünde. Freilich kann die Schuld durch Propagandaeinfluss o. Ä. gemindert sein.
Dass Atheismus eine Sünde ist, müssten eigentlich auch Nichtchristen erkennen, die noch nichts von Gottes Offenbarung gehört haben; die Existenz eines Schöpfers kann man allein mit der Vernunft erkennen, und dann ist es nur logisch, dass man dem Dankbarkeit und Ehrfurcht dafür erweist, dass er einen ins Dasein gerufen hat.
Undankbarkeit gegenüber Gott oder Überdruss gegenüber geistlichen Dingen (acedia) (denen man innerlich mit dem Willen zustimmt), sind je nach dem einzelnen Fall mehr oder weniger gravierende Sünden, und öfter mal das Motiv für äußere Sünden gegen die Gottesverehrung.
Jetzt zu weiteren möglichen Sünden gegen dieses Gebot, bei denen es nicht um ein Fehlen der Verehrung, sondern um eine falsche Verehrung geht, was der hl. Thomas unter dem Oberbegriff Aberglaube (superstitio) zusammenfasst. Es gibt verschiedene Arten davon.
Man kann den wahren Gott auf eine unangemessene oder falsche Weise verehren, z. B. indem man im Neuen Bund noch die Zeremonien des Alten Bundes pflegt; indem man Wunder oder falsche Privatoffenbarungen erfindet oder Reliquien fälscht; indem man neue Formen des Gottesdienstes einführt, die Irriges oder Unsinniges über Gott aussagen (z. B. Fürbitten für Dinge hält, die gegen Gottes Gebote verstoßen, Beziehungen segnet, die gegen Gottes Gebote verstoßen, wie Zweit“ehen“ nach Scheidungen); indem man Gottesdienst auf eine Weise feiert, die die Kirche nicht vorsieht; u. Ä. Dazu sagt der hl. Thomas: „Denn wie das ein Fälscher ist, der Aufträge von einem anderen ausrichtet, die ihm nicht anvertraut worden sind; so thut der Diener der Kirche etwas Falsches, der seitens der Kirche einen Kult Gott darbringt, welcher gegen den von der Kirchenautorität gebilligten Kult verstößt.“ (Summa Theologiae II/II,93,1)
Bei Geringfügigkeit und Mangel an bösem Willen & bewusstem Übertreten des Gebots wäre das oft nur lässliche Sünde; falscher Kult kann aber in schwerwiegenderen Fällen auch schwere Sünde sein; ein mögliches Beispiel wäre, wenn ein Priester einen Gottesdienst für ein Paar feiern würde, das nicht gültig kirchlich heiraten kann, weil einer von ihnen schon mit jemand anderem gültig verheiratet ist.
Der Gottesdienst ist Gottesdienst der gesamten Kirche, den sie dem Herrn darbringt; der einzelne nimmt daran teil und findet sich in diese Gemeinschaft hinein, und muss und darf ihn sich nicht nach eigenem Geschmack neu erfinden; sonst wird der einzelne Mensch / die einzelne Pfarrei o. Ä. statt Gott in den Mittelpunkt gestellt; deshalb sind liturgische Missbräuche Sünde. Außerdem haben die Laien das Recht, in jedem katholischen Gottesdienst auf der Welt das vorzufinden, was allgemein vorgesehen ist.
Aberglaube, der in einer falschen Form der Verehrung des richtigen Gottes besteht, kann eine Art „Exzess“ in der Gottesverehrung sein; oder besser gesagt, nicht in der Gottesverehrung selbst, wo man nicht zu viel tun kann, sondern in bestimmten Dingen, die zur Gottesverehrung gehören, und die aus ihrem Zusammenhang gerissen und unnötig übertrieben werden:
„Was aber zur Unterwerfung von Leib und Seele unter Gott und zu seiner Ehre nicht gehört oder absieht von der Anordnung Gottes und der Kirche oder gegen den gemeinen Brauch (welcher nach Aug. ep. 36. Gesetzeskraft hat) ist; das Alles ist als überflüssig und abergläubisch zu betrachten, weil es nur in Äußerlichkeiten bestehend zum inneren Kulte Gottes nicht gehört. Deshalb wendet Augustin (de vera Relig. c. 3.) das Wort des Herrn: ‚Das Reich Gottes ist in euch‘ gegen die Abergläubischen an, die hauptsächlich auf Äußerliches achtgeben.“ (Summa Theologiae II/II,93,2)
Man kann auch etwas wie Gott verehren, das nicht Gott ist. Zunächst mal richtete sich das 1. Gebot, das Mose am Sinai von Gott kommuniziert wurde, vorrangig gegen den Götzendienst (Idolatrie), also dagegen, irgendeinem anderen angeblich oder tatsächlich existierenden Wesen oder Ding gottgleiche Ehren zukommen lassen: Keine Opfer dem Baal, dem Moloch und der Astarte. Heute sind zwar wenige Christen in Versuchung, dem Baal, dem Moloch und der Astarte zu opfern, aber natürlich hat dieses Gebot noch seine Bedeutung. Es gibt in einigen Ländern (z. B. Indien) und natürlich in neuheidnischen Kreisen sehr wohl noch die Verehrung anderer Götter und Geister; es gibt Pantheisten, die die Natur als göttlich verehren. Alles Idolatrie und nicht erlaubt: Nur einer ist der Urgrund allen Seins und verdient Anbetung, und Er steht außerhalb der Welt, ist allmächtig, allwissend, allgütig, der Schöpfer und der Richter. Die schlimmste Art der Idolatrie – und deutlich schlimmer als gutgläubiger Poly- oder Pantheismus, der mehr ein Irrtum bei einem an sich guten religiösen Impuls sein kann – wäre der Satanismus.
Es ist auch materielle Idolatrie, nur die äußere Handlung zu vollziehen, die anderen zeigt, dass man etwas anbetet, auch wenn man innerlich nicht an diese anderen Götter glaubt, also z. B. wenn Christen in der Antike dem Kaiserbild Weihrauch opferten, um nicht als Christen verurteilt zu werden; dazu sagt Thomas: „Denn da der äußere Kult nur ein Zeichen ist des inneren, so ist es ebenso eine verderbliche Lüge, wenn jemand einen äußeren Kult erweist jenem, dem er denselben in seinem Innern verweigert; als wenn jemand mit Worten den wahren Glauben leugnet, den er im Innern festhält.“ (Summa Theologiae II/II,94,2) Formelle Idolatrie wäre die wirkliche Anbetung.
Die Idolatrie (sowohl materiell als auch formell) ist an sich eine schwere Sünde. Der hl. Thomas hält sie sogar für theoretisch, wenn auch nicht immer praktisch, die schwerste: „Wird die Sünde des Götzendienstes an sich betrachtet, so ist keine Sünde schwerer. Denn wie im irdischen Gemeinwesen am schwersten sich verfehlt, wer königliche Ehren einem anderen erweist wie dem wahren Könige, weil er dadurch die ganze staatliche Ordnung verkehrt; ist unter den Sünden, welche unmittelbar gegen Gott sich wenden, also unter den größten, die größte der Götzendienst, weil der Götzendiener sich einen anderen Gott macht und so den göttlichen Vorrang vermindert. Kommt freilich die Verfassung des Sünders in Betracht, insoweit wer aus Unkenntnis z. B. sündigt minder sündigt wie jener, der aus Bosheit, mit Vorwissen nämlich sündigt, so steht dem nichts entgegen, daß die Häretiker schwerer sündigen, die mit Vorwissen den Glauben verderben, wie die Götzendiener, die unwissend sündigen. Und so können auch andere Sünden größer sein, die mehr aus innerer Verachtung und Bosheit des Sünders hervorgehen.“ (Summa Theologiae II/II,94,3)
Von spirituellen Praktiken aus östlichen Religionen und esoterischen Sekten, die Pantheismus, Monismus o. Ä. voraussetzen, sollte man sich fernhalten. Manchmal taucht die Frage nach Yoga auf; hier ist es einfach so, dass es zwar prinzipiell moralisch erlaubt wäre, die körperlichen Übungen (z. B. gegen Rückenschmerzen) anzuwenden, wenn sie helfen, aber nicht die mit Yoga verbundene Spiritualität zu übernehmen. Und da Yoga-Kurse meistens beides vermischen und es schwierig ist, den hinduistischen Ursprung einfach auszublenden, sind sie in der Praxis einfach besser zu meiden. Übungen gegen Rückenschmerzen gibt es auch ganz ohne Yoga. Selbst die körperlichen Posen sind von Yoga-Praktizierenden als Symbole für die Verehrung von Hindu-Göttern gemeint; und auch, wenn man diese „Götter“ nicht verehrt, kann man falsche Ideen über die Vereinigung mit dem pantheistisch gedachten Universum, quasi die Selbstvergöttlichung, übernehmen.
Man bezeichnet es öfter als Quasi-Götzendienst, etwas anderes (z. B. Besitz, Selbstoptimierung, Ansehen, eine Nation, eine Partei…) praktisch an die Stelle Gottes zu setzen; das ist allerdings etwas, das prinzipiell irgendwo bei jeder Sünde geschieht; dabei wird immer etwas anderes Gott vorgezogen. Somit kann man sagen, dass jede Sünde im übertragenen Sinn etwas von Idolatrie hat, aber eben nur im übertragenen Sinn. Eine formelle Vergötterung z. B. der Natur, des Schicksals, der Ahnen, oder auch ein ausdrückliches, bewusstes Vorziehen der Parteidoktrin gegenüber der göttlichen Offenbarung wäre etwas anderes.

(Anbetung des Goldenen Kalbes, Fuldaer Weltchronik. Gemeinfrei.)
Aberglaube im engen Sinn ist es, einem Ding oder Wesen Kräfte zuzuschreiben (oder sich selber anzumaßen), die es nach der Ordnung in Gottes Schöpfung nicht besitzt, wobei das Ziel normalerweise ist, sich besondere Macht oder Wissen über sein Schicksal zu verschaffen. Schutzamulette und Glücksbringer etwa sind Aberglaube und ihr Gebrauch verstößt gegen die Vernunft und gegen Gottes Ordnung.
Auch manche auf den ersten Blick katholischen wirkenden Praktiken können abergläubisch werden; es ist Aberglaube, einem bestimmten Gebet oder Heiligenbild o. Ä. unfehlbare Wirkung aus sich heraus zuzuschreiben – wenn ich diese Worte aufsage oder dieses Ding bei mir trage, kann ich gar nicht in die Hölle kommen, oder nicht krank werden, oder was auch immer, und weiter muss ich auch nichts tun. Hier meint man, Gott quasi mechanisch bezwingen zu können und vergisst, dass solche Sakramentalien die Kooperation des freien Willens und den festen Glauben brauchen. (Das trifft natürlich nicht Rituale, die Gott selbst befohlen hat und bei denen Er eine bestimmte Wirkung unter bestimmten Umständen eindeutig zugesagt hat; sprich die Sakramente; so wirkt z. B. die mit der richtigen Intention gesprochene Taufformel zusammen mit dem Taufwasser, oder die Konsekrationsformel, die ein gültig geweihter Priester mit der richtigen Intention über Brot und Wein spricht, tatsächlich immer, aber eben durch Gott.)
Solche Dinge (Talismane, Verwendung von Heiligenbildern wie Talismane, usw.) sind in der Praxis oft nur lässliche Sünden, z. B. bei Leuten, die in dieser Hinsicht einfach naiv und leichtgläubig sind und sich nicht wirklich bewusst sind, etwas Falsches zu tun; aber prinzipiell kann Aberglaube eine schwere Sünde sein; die Sünde liegt oft vor allem in der Irrationalität, und bei Aberglaube, der mit Gott nichts zu tun hat, in der Bindung an vage erahnte andere Mächte statt dem Vertrauen auf den persönlichen Gott, den man erkannt hat.
Abergläubisch ist es auch, vermeintlichen Omen Bedeutung zuzuschreiben, auf schlechte Vorzeichen oder Unglückstage zu achten (Freitag der 13. usw.), und Wahrsagerei zu betreiben (Astrologie, Handlesen, Bleigießen etc.), bei der man Macht haben will, die Zukunft zu wissen, die nur Gott kennt. Bei der Wahrsagerei findet man manchmal auch einen gewissen Fatalismus, einen Glauben an eine Vorherbestimmung, die den freien Willen beiseiteschiebt.
Der hl. Thomas sortiert die Wahrsagerei in drei Kategorien: 1) Bloße Beobachtung von scheinbaren Omen (z. B. Astrologie); 2) das Tun von etwas, aus dem die Zukunft erkannt werden soll, also das Bewirken scheinbarer Omen (z. B. Bleigießen); 3) das ausdrückliche Anrufen von Geistern/Dämonen, die einem die Zukunft offenbaren sollen. Letzteres ist am schlimmsten, besonders, wenn man hier einen anderen Geist als Gott Verehrung/Opfer zukommen lässt.
Das, was man „Hexerei“ oder heute eher „Okkultismus“ nennt, gibt es bekanntlich auch heute noch; besonders z. B. in afrikanischen Ländern, aber nicht nur. Hierzu gehört es auch, wenn Spiritisten Gläserrücken veranstalten oder ein „Medium“ einen Geist durch sich weissagen lassen will. Dabei öffnet man sich leider immer irgendwo für die Welt der Dämonen, auch wenn man sagt, man will nur gute Geister oder Geister von Toten erreichen.
Es gibt nun mal gefallene, von Gott abgewandte Engel, die auch Gottes anderen Geschöpfen, den Menschen, feindlich gesonnen sind, und ja, sie können Zugang zu Menschen finden, die sich für sie öffnen; hierher können u. U. auch dämonische Belastung und im Extremfall Besessenheit kommen, weshalb die Kirche einzelne Priester als Exorzisten beauftragt, um über Betroffene Befreiungsgebete zu sprechen. Auch wenn in vielen Fällen Betrug, Autosuggestion u. Ä. als Erklärung genügen: Es gibt wirklich unerklärliche Phänomene bei Spiritismus/Okkultismus. Wenn hier Geister antworten, ist es natürlich schon deshalb falsch, diesen Geistern Glauben zu schenken, weil die Dämonen irgendwann und irgendwo mit Lügen kommen werden und einem höchstens vorläufig die Wahrheit sagen, um einen später zu täuschen; die Zukunft unfehlbar vorherwissen können sie außerdem nicht, sondern sie höchstens abschätzen, weil sie intelligenter als Menschen sind. Gute Engel und Verstorbene antworten natürlich nicht auf solche lächerlichen Herbeizitierungsversuche; wenn Gott ihnen erlaubt, einem zu erscheinen, kommen sie von selbst (den Einwand, dass Samuel Saul bei so etwas erschienen sei, beantwortet der hl. Thomas mit einem Verweis auf Augustinus hier).
Am schlimmsten sind Schadenszauber/Flüche, bei denen man bewusst Geister anruft, die schaden sollen. Das ist etwas, das z. B. in Afrika noch sehr häufig vorkommt; aber es gibt es sehr wohl auch im Westen; in den USA etwa haben sich selbst ernannte Hexen aus neopaganen Kreisen schon daran gemacht, unliebsame Politiker zu „verhexen“.
Kann Hexerei, bei der jemand Geister anruft und bei der die Dämonen tatsächlich antworten, wirken? Erlaubt Gott den Dämonen die Macht, einen Schadenszauber wirksam werden zu lassen? Gute Frage, die aber über das Thema dieses Artikels hinausgeht; jedenfalls können sie, falls das je der Fall sein sollte, durch das vertrauensvolle Gebet zu Gott unschädlich gemacht werden.
Wenn jemand Gott bitten würde, ihm ein die Zukunft betreffendes Zeichen zu senden, wäre das kein Aberglaube, schließlich unterwirft man sich hier Gott und es ist nur eine Bitte. Andere bewusst durch Wahrsagerei o. Ä. zu betrügen ist eine schwere Sünde; nicht nur wegen des Betrugs, sondern auch wegen der Verführung zum Aberglauben. Wenn man z. B. sein Horoskop liest, um sich darüber lustig zu machen, ist das keine Sünde; wenn man halbernst mit solchen Dingen umgeht und sie aus Neugier testen will, weil man sich innerlich denkt, dass vielleicht doch etwas dran sein könnte, ist das schon Sünde, wenn auch vielleicht nicht immer schwere. Wenn jemand wegen einer vagen abergläubischen Furcht etwas an sich Indifferentes meidet (z. B. einen Termin nicht auf einen Freitag den 13. legt), wäre das eher nur lässliche Sünde. Moralisch in Ordnung sein kann es, abergläubische Dinge, die von anderen betrieben werden, zu beobachten, um zu sehen, ob bewusster Betrug dahintersteckt oder es andere natürliche Erklärungen gibt; falsch und gefährlich wäre es allerdings, z. B. jemanden erst zu einer Séance anzustiften, weil man hier einem anderen Anlass zur Sünde wird, oder selbst eine durchzuführen, weil man damit experimentieren will.
Eine Frage bleibt hier noch: Was ist mit Götterbildern? In der Bibel heißt es beim 1. Gebot: „Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen.“ (Ex 20,2-5)
Das Gebot, kein Gottesbild zu machen, betraf natürlich vor allem die Anfertigung von Bildern anderer Götter; aber im Alten Bund war auch die Anfertigung von Bildern des wahren Gottes verboten, um den Israeliten beizubringen, dass Gott erstens völlig anders als alles Irdische und sich nicht in einem Bild einfangen lässt, und zweitens zu verhindern, dass sie die Bilder selbst anbeteten, da man in den damaligen heidnischen Kulten, von denen Israel umgeben war, Götterbilder selbst für göttlich hielt.
Dieses Gebot gilt im Neuen Bund nicht mehr, weil diese direkte Notwendigkeit weggefallen ist, aber hauptsächlich, weil Gott sich selbst in Jesus ein Angesicht gegeben hat. (Vgl. dazu die Aussagen des 2. Konzils von Nizäa.)
(Alle Bilder waren aber auch im Alten Bund nicht verboten: Gott selbst befiehlt z. B. die Anfertigung der Kerubim für die Bundeslade.)
Dann gibt es Sünden, die sich quasi direkt gegen Gott richten, statt etwas an Seine Stelle zu setzen oder Ihn auf falsche Weise zu verehren.
Eine solche Sünde wäre: Gott versuchen/herausfordern. Hier ist gemeint, eine Eigenschaft Gottes in Frage zu stellen, wie seine Allmacht oder vollkommene Güte. „Wenn Gott wirklich gut ist, soll Er es mir hiermit beweisen.“ Die Sünde liegt hier einfach darin, dass man etwas, auf das man vertrauen kann und muss, weil man es mit der Vernunft erkannt hat, preisgibt, wenn man irgendwie angefochten wird. An sich schwere Sünde. Vgl. dazu auch die Versuchung Jesu durch den Teufel und Seine Antwort: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.“ (Matthäus 4,7)
Eine implizite Herausforderung Gottes (die in einer wenig schwerwiegenden Angelegenheit nur lässliche Sünde sein kann) ist es, wenn man sich darauf verlässt, dass Gott für einen ein Wunder wirken wird (was schließlich niemand einfordern kann und niemandem versprochen wurde), oder sich ohne jeden Grund in große Gefahr für Seele oder Leben begibt und erwartet, dass Gott einem heraushelfen wird. (Wenn man so etwas nur z. B. als Mutprobe tut, ohne Gottes Hilfe zu erwarten, ist es zwar auch eine Sünde, aber eine gegen das 5., nicht gegen das 1. Gebot; gegen die Selbstliebe, nicht gegen Gott.)
Es ist etwas ganz anderes, sich mit gutem Grund in eine Gefahr zu begeben, und darauf zu vertrauen, dass Gott einem irgendwie helfen wird.
Der hl. Thomas unterscheidet außerdem: „Wenn also jemand ein Zeichen von Gott erbittet, um Gottes Macht, Güte, Weisheit zu erproben, so heißt das: Gott versuchen; — fleht er um ein Zeichen, damit er belehrt werde, welches in einem besonderen Falle der Wille Gottes, sei; so ist dies keine Sünde.“
Und: „Wenn aber der versuchende Gottes Gewalt anderen zeigen will, ist das keine Sünde; denn es liegt dann für das Versuchen eine rechtmäßige Notwendigkeit vor oder ein frommer Nutzen und all jenes Andere, was, damit dies erlaubt sei, gegeben sein muß. So baten die Apostel den Herrn, daß im Namen Jesu Zeichen geschähen, nach Act. 4.; damit nämlich Christi unendliche Mächt offenbar werde.“ (Summa Theologiae II/II,97,2)
Eine weitere Sünde wären Sakrilegien, wobei etwas, das Gott geweiht ist, verunehrt wird. Sakrilegien können sich auf Personen, Orte und Sachen beziehen.
Bzgl. Personen: Hier geht es um Gott in besonderer Weise geweihte, für seinen Dienst ausgesonderte Personen, also geweihte Kleriker, und Menschen mit öffentlichen Gelübden, v. a. Ordensleute (Personen mit Privatgelübde zählen streng genommen nicht dazu). Sakrilegien in Bezug auf gottgeweihte Personen wären Unkeuschheitssünden von/mit/an ihnen (gewollte Gedankensünden eingeschlossen), physische Verletzung von ihnen (Tötung, Körperverletzung), und Entfremdung vom Gottesdienst – also wenn ein Staat Priester zum Militärdienst einziehen will o. Ä. Sonstige Verbrechen gegen sie, die sich nicht besonders gegen ihren Gott gewidmeten Charakter beziehen, wären keine Sakrilegien (z. B. begeht ein Taschendieb, der eine Nonne bestiehlt, nur einen Diebstahl, kein Sakrileg).
Bzgl. Orten: Hier sind Handlungen in Kirchen, Kapellen, Privatkapellen, Heiligtümern, auf Altären und Friedhöfen gemeint, die die Heiligkeit des Ortes verletzen, also schwere äußere Sünden (Blutvergießen, Unzucht…), profane Tätigkeiten, die die Heiligkeit des Ortes klar verletzen (also z. B. wenn man in einer Kirche einen Jahrmarkt veranstalten würde, vgl. dazu auch die Tempelreinigung durch Jesus), oder ein Einbruch in eine Kirche, oder solche Verbrechen von Kirchengegnern, die darauf zielen, einen heiligen Ort zu entweihen. In Can. 1211 heißt es über besonders schwere und öffentlich bekannte Sakrilegien:
„Heilige Orte werden geschändet durch dort geschehene, schwer verletzende, mit Ärgernis für die Gläubigen verbundene Handlungen, die nach dem Urteil des Ortsordinarius so schwer und der Heiligkeit des Ortes entgegen sind, daß es nicht mehr erlaubt ist, an ihnen Gottesdienst zu halten, bis die Schändung durch einen Bußritus nach Maßgabe der liturgischen Bücher behoben ist.“
Ein bloßer Mangel an Ehrfurcht, der noch nicht allzu schlimm wird, wäre eher lässliche Sünde; also solche Sachen wie: Beim Besuch einer Kirche als Tourist etwas essen oder trinken oder laut reden oder schlampig angezogen sein; beim Betreten der Kirche als Mann den Hut nicht abnehmen. Moralisch erlaubt wäre z. B., im Eingangsbereich einer Kathedrale einen Shop mit Rosenkränzen und Gebetbüchern betreiben, wenn dabei das eigentliche Geschehen in der Kirche nicht gestört wird; als Obdachloser in einer Kirche übernachten, wenn man keine andere Möglichkeit hat; oder religiöse Konzerte, Benefizkonzerte, religiöse Vorträge o. Ä. in Kirchen, die die Kirche erlaubt. Vgl. dazu:
„Can. 1210 — An einem heiligen Ort darf nur das zugelassen werden, was der Ausübung oder Förderung von Gottesdienst, Frömmigkeit und Gottesverehrung dient, und ist das verboten, was mit der Heiligkeit des Ortes unvereinbar ist. Der Ordinarius kann aber im Einzelfall einen anderen, der Heiligkeit des Ortes jedoch nicht entgegenstehenden Gebrauch gestatten.“
Bzgl. Sachen: Hier geht es um die Entehrung der Sakramente (s. ein Stück weiter unten) oder von gesegneten, für einen religiösen Zweck gedachten Gegenständen, wie z. B. Heiligenstatuen, Kruzifixen, liturgischen Geräten, die ausschließlich für den Gottesdienst gedacht sind, etc. In Can. 1171 heißt es „Heilige Sachen, die durch Weihung oder Segnung für den Gottesdienst bestimmt sind, sind ehrfürchtig zu behandeln und dürfen nicht zu profanem oder ihnen fremdem Gebrauch verwendet werden, selbst dann nicht, wenn sie Eigentum von Privatpersonen sind.“ So ein Sakrileg wäre z. B., eine Heiligenstatue mit spöttischen Slogans zu bekritzeln oder eine Patene als normalen Teller zu verwenden.
Nicht mehr brauchbare heilige Gegenstände (wie eine kaputte gesegnete Heiligenstatue oder einen kaputten gesegneten Rosenkranz, ein Skapulier, einen Palmboschen aus dem Vorjahr, etc.) würde man nicht einfach in den Müll werfen, sondern auf gesonderte respektvolle Weise entsorgen – z. B. durch Verbrennen oder Vergraben, oder dadurch, sie in möglichst kleine Teile zu brechen, bis sie nicht mehr erkennbar sind, und diese Teile wegzuwerfen. (So wird verhindert, dass sie in ihrer bestehenden Form unwürdig behandelt werden.) Ähnliches gilt auch für verdorbene konsekrierte Hostien, wobei es hier natürlich wesentlich schwerwiegender wäre, sie einfach wegzuwerfen. – Eine religiöse Zeitschrift oder einen Flyer, auf dem auch Abbildungen von Heiligen oder Heiligenbildern abgedruckt sind, ins Altpapier oder den Müll zu werfen, ist kein Sakrileg; hier handelt es sich sowieso nicht um zur Verehrung gedachte Bildnisse, sondern nur um Abdrucke zur Information oder Illustrierung; gesegnet sind sie auch nicht. Auch Andachtsbildchen sind nicht gesegnet und können wie normale Bilder behandelt werden, das gleiche gilt für Gebetbücher u. Ä.
Auch normale Dinge des Alltagsgebrauch, die gesegnet wurden, auf normale Weise zu verwenden, ist kein Sakrileg (z. B. die Eierschalen von in der Osternacht gesegneten Ostereiern wegzuwerfen – auch wenn es ein frommer Brauch ist, sie stattdessen zu verbrennen). Die waren ja nicht speziell für den Gottesdienst gedacht.
Außerdem begeht ein Sakrileg, wer Dinge, die zum Gottesdienst gedacht sind, unrechtmäßig in seinen Besitz bringt – also z. B. ein Dieb, der liturgische Gefäße stiehlt, oder eine Regierung, die Kirchen konfisziert.
Auch Worte der Hl. Schrift für schlechte Dinge (z. B. Hassparolen gegen Gott) zu missbrauchen ist ein Sakrileg.
Auch der Empfang oder die Spendung der Sakramente im Stand der Todsünde ist ein Sakrileg; wobei es, wenn ein Priester im Stand der Todsünde ist und z. B. die Messe feiern muss, bevor er beichten kann, genügt, wenn er vollkommene Reue erweckt und sich vornimmt, möglichst bald zu beichten; unter dringenden Umständen kann auch ein Laie in so einer Situation ein Sakrament empfangen, aber eben nur mit Reue. Wenn jemand im Stand der Todsünde und ohne Reue (also unwürdig) Sakramente wie z. B. das Sakrament der Firmung oder der Ehe empfangen hat, wurden sie gültig, aber unwirksam empfangen; d. h. derjenige ist zwar gefirmt oder verheiratet, aber die besondere Gnadenwirkung bleibt aus und lebt erst wieder auf, wenn er sich bekehrt.
Das schlimmstmögliche Sakrileg wäre natürlich eins bzgl. des Allerheiligsten Sakraments; auch eine Beichte ohne Reue wäre sehr schlimm; aber zu beidem in anderen Beiträgen eigens genauer.
Sakrilegien sind immer schlimmer, wenn sie mit der Absicht passieren, etwas Heiliges zu entweihen, nicht aus bloßer Gleichgültigkeit, oder aus bloßer Unachtsamkeit; außerdem kommt es natürlich darauf an, wogegen genau sich ein Sakrileg richtet. Es ist offensichtlich ein großer Unterschied, ob jemand einen kaputten gesegneten Rosenkranz wegwirft, weil er sich keine Gedanken darum gemacht hat, dass es dafür besondere Regeln geben könnte (keine oder höchstens lässliche Sünde), oder ob jemand aus Hass auf Gott eine Schwarze Messe mit einer konsekrierten Hostie feiert (sehr schwere Sünde).
Der hl. Thomas schreibt über die verschiedene Schwere von Sakrilegien an Sachen:
„Unter den übrigen heiligen Sachen stehen nun an der Spitze die Sakramente selber; und unter diesen ist das erste die heilige Eucharistie, welche Christum selber enthält. Der Gottesraub also, der sich gegen dieses Sakrament richtet, ist der schwerwiegendste von allen. Nach den Sakramenten kommen dann die heiligen Gefäße, die den Sakramenten dienen; die heiligen Bilder, die Reliquien der Heiligen, in denen die Personen dieser Heiligen selbst gleichsam geehrt oder verunehrt werden; — dann was zum Schmucke der Kirchen und der Diener des Kultus gehört; — und endlich für den Unterhalt der letzteren bestimmt ist, seien dies bewegliche oder unbewegliche Dinge.“ (Summa Theologiae II/II,99,3)
Eine weitere Sünde gegen das 1. Gebot (die allerdings heute zum Glück keine besonders große Rolle mehr spielt) wäre die Simonie (benannt nach Simon dem Magier aus Apostelgeschichte 8), also der Versuch, geistliche Dinge für zeitliche Dinge zu kaufen oder zu verkaufen.
Diese geistlichen Güter sind: Die Gnadengaben des Heiligen Geistes, die Sakramente, Sakramentalien, Gebete, die Ausübung der kirchlichen Jurisdiktion („wenn Sie mir nichts geben, bekommen Sie keinen Prozess vor dem Kirchengericht wegen Ihrer Ehenichtigkeitsklage“), Ablässe, Weihen, Segnungen, Aufnahme in einen Orden, ein kirchliches Amt.
Der hl. Thomas gibt die Gründe, aus denen Simonie Sünde ist, folgendermaßen an:
„Gegenstand des Kaufens oder Verkaufens aber zu sein, ist für eine geistige Sache ungehörig aus drei Gründen: 1. Nichts Geistiges kann in einem zeitlichen Preise seinen vollentsprechenden Wert finden; denn, wie Prov. 3. von der Weisheit gesagt wird, ist es kostbarer als alle Schätze; und Alles, wonach man trachtet, kann nicht mit ihm verglichen werden; weshalb Petrus zu Simon sagte (Act. 8.): ‚Sei dein Geld mit dir verflucht, weil du die Gabe Gottes einer Summe Geld gleichgeachtet hast.‘ 2. Der Kirchenvorsteher ist nicht Herr der geistigen Dinge, sondern nur deren Verwalter, nach 1. Kor. 4.: ‚So erachte uns der Mensch wie Diener Christi und wie Verwalter der Geheimnisse Gottes‘; also kann er nicht verkaufen, was er nicht besitzt. 3. Solcher Verkauf widerspricht dem Ursprünge der geistigen Güter; denn ‚umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet‘, sagt der Herr. (Matth. 10.)
Wer also eine geistige Sache kauft oder verkauft, der sündigt durch Mangel an Ehrfurcht vor Gott; und somit sündigt er gegen die Tugend der Gottesverehrung.“ (Summa Theologiae II/II,100,1)
Wenn jemand einem anderen etwas Zeitliches gibt ohne direkt vereinbarten Handel, aber mit dem hauptsächlichen Ziel, ihn dazu zu bewegen, ihm im Gegenzug ein geistliches Gut zu geben, ist das auch Simonie. Wenn jemand so etwas nur unter anderem mit der Hoffnung tut, dass nebenbei etwas Geistliches herausspringen könnte, ist es keine Simonie.
Es ist keine Simonie, wenn es üblich ist, anlässlich z. B. einer Messe für verstorbene Verwandte oder der Taufe eines Kindes dem Pfarrer einen bestimmten Geldbetrag zu geben. Bei Stolgebühren usw. geht es darum, dass Priester irgendwie ihre Ausgaben decken und für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen, weshalb es übliche Spenden anlässlich gewisser Gelegenheiten gibt, wobei jemandem, der nichts spenden kann, die Sakramente aber nicht verweigert werden. Das ist so wenig Simonie, wie Verwaltungsgebühren, die für die Bezahlung von Beamten verwendet werden, Beamtenbestechung sind; hier geht es ja gerade darum, dass jeder den gleichen kleinen festgesetzten Beitrag gibt, und der Klerus dann nicht auf Bestechungsgelder aus sein muss. (Freilich ist es wichtig, hier den Anschein der Simonie zu vermeiden.)
Vgl. dazu im CIC: „Can. 848 — Der Spender darf außer den von der zuständigen Autorität festgesetzten Stolgebühren für die Sakramentenspendung nichts fordern; er hat immer darauf bedacht zu sein, daß Bedürftige nicht wegen ihrer Armut der Hilfe der Sakramente beraubt werden.“
Materielle Dinge, die später der Gottesverehrung dienen sollen, wie kleine Heiligenstatuen, Rosenkränze usw., zu produzieren und zu verkaufen, ist natürlich auch keine Simonie.
Es ist Simonie, Reliquien zu verkaufen, aber nicht, sie zu kaufen, um zu verhindern, dass sie in falsche Hände geraten und unwürdig behandelt werden. Zum Umgang mit Reliquien s. im CIC:
„Can. 1190 — § 1. Es ist verboten, heilige Reliquien zu verkaufen.
§ 2. Bedeutende Reliquien und ebenso andere, die beim Volk große Verehrung erfahren, können ohne Erlaubnis des Apostolischen Stuhls auf keine Weise gültig veräußert oder für immer an einen anderen Ort übertragen werden.
§ 3. Die Vorschrift des § 2 gilt auch für Bilder, die in einer Kirche große Verehrung beim Volk erfahren.“
Simonistische Verträge/Vereinbarungen sind ungültig (Ausnahme: ein per Simonie ins Amt gewählter Papst wäre gültig zum Papst gewählt) und entsprechende erhaltene zeitliche Güter zurückzuerstatten; die Simonie ist an sich schwere Sünde.
Beim nächsten Mal weiter mit dem zweiten Gebot.
Gefällt mir Wird geladen …